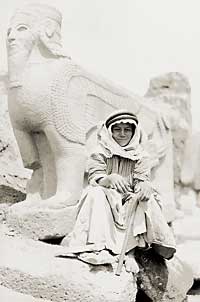Max von Oppenheim -
Forscher, Sammler, Diplomat
Der aus Köln stammende Orientforscher Max Freiherr von
Oppenheim (1860-1946) lebte gegen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts
viele Jahre als deutscher Diplomatin Kairo und Istanbul, wo er aktiv an der
internationalen Politik teilnahm und Forschungen zur Geschichte der arabischen
Völker durchführte. Er erfüllte sich damit einen Kindheitswunsch,
den er seit seiner Schulzeit hegte. Doch zunächst strebte Oppenheim entsprechend
dem Wunsche seines Vaters nach einer seriösen Ausbildung. Wenn er auch
nicht der Familientradition des Bankhauses Sal. Oppenheim jr.&Cie. folgte,
so immatrikulierte er sich doch erst einmal im Fach Jura. Nach seinem Referendariat
in Köln wechselte Oppenheim an das Regierungspräsidium in Wiesbaden.
Von dort aus begleitete er im Winter 1883/84 seinen Onkel auf eine Reise in
die osmanische Türkei, bei derer nun erstmals den Orient kennenlernte,
der ihn sofort ganz in seinen Bann zog.
Nach seiner Rückkehr richtete sich Max von Oppenheim in seiner Wiesbadener
Wohnung ein türkisches Zimmer ein. Im Jahre 1892 unternahm er zusammen
mit dem Mitbegründer des Rautenstrauch-Joest-Museums, dem Völkerkundler
Wilhelm Joest, eine Forschungsreise von Marokko aus quer durch Nordafrika
nach Kairo, wo er sieben Monate in einem traditionellen Haus in einem arabischen
Viertel wohnte. Als Kenner der orientalischen Bräuche fiel ihm das opulente
Leben arabischer Prägung nicht schwer.1896 trat Oppenheim in den diplomatischen
Dienst und wurde dem kaiserlichen Generalkonsulat in Ägypten zugeteilt,
eine Tätigkeit, die er bis 1909 ausübte. Damit begann sein "Doppelleben"
als "Araber" und als Mitglied der privilegierten diplomatischenKreise.
Die exotische Intimität seines Privatlebens konnte Max von Oppenheim
während seiner Zeit in Kairo absolut verborgen halten, und der "Harem"
seines Hauses blieb seinen europäischen Gästen ebenso unbekannt
wie die sagenumwobenen Frauengemächer der osmanischen Sultane.
Auf verschiedenen mehr oder weniger ausgedehnten Forschungsreisen suchte
Oppenheim Kontakt zu lokalen Stammesführern, um sich über die politischen
und sozialen Verhältnisse zu informieren. Besonderes Interesse galt bei
seinen Forschungen den Beduinenstämmen. Ausführlich dokumentierte
Oppenheim, der die arabische Sprache und die Stammesdialekte fließend
sprach, die gesellschaftliche Struktur und verwandtschaftlichen Zusammenhänge
der Beduinen und veröffentlichte sie genauso in teilsmehrbändigen
Werken wie weitere Arbeiten über Reiseeindrücke, sozialpolitische
Verhältnisseim Orient sowie Teile seiner archäologischen Forschung.
Oppenheim war schon immer fasziniert von der Archäologie gewesen, der
er vor allem nach 1899 durch einen schicksalhaften Zufall größere
Beachtung schenkte. Während einer Erkundungsreise im Rahmen der Streckenplanung
der Bagdad-Bahn entdeckte er den hethitischen Siedlungshügel Tell Halaf
in Syrien, wo die älteste bekannte prähistorische Buntkeramik aus
dem sechsten Jahrtausend v.Chr. zu Tage kam. Besonders beeindruckende Funde
sind die reliefierten Steinplatten (Orthostaten) und Großplastiken.
Max von Oppenheim sah sich nun zunehmend als Archäologe und finanzierte,
nachdem er vorläufig aus dem diplomatischen Dienst getreten war, aus
eigenen Mitteln seineGrabungen, die er 1913 nach zweieinhalbjähriger
Dauer erst einmal abschloss. Erst nach den Wirren des Ersten Weltkriegs, starken
persönlichen Finanzeinbußen und dem Zusammenbruch des Osmanischen
Reichs konnten ab 1927 weitere Grabungskampagnendurchgeführt werden.
Während des Ersten Weltkriegs wurde Oppenheim 1914 als Sonderbotschafter
nach Istanbul geschickt, um dort als Begründer der "Nachrichtenstelle
für den Orient" die politischen Entwicklungen zu beobachten.
Neben seinen diplomatischen und archäologischen Tätigkeiten widmete
sich Max von Oppenheim Zeit seines Lebens einer intensiven Sammlertätigkeit
islamischen Kunsthandwerks. Er trug exemplarisch jene Stücke aus dem
Vorderen Orient zusammen, die zu jener Zeit erhältlich waren. Systematisch
suchte er nach Objekten, die stellvertretend für bestimmte Gruppen und
Epochen standen. Nach seinen Aufenthalten im Nahen Osten wurden die Sammlungen
nach Berlin transportiert, wo sie von einem Mitarbeiterstab im Rahmen der
von ihm begründeten "Max Freiherr von Oppenheim-Stiftung" erstmalig
inventarisiert und beschrieben wurden. Vornehmliches Ziel der Stiftung war
es allerdings, die archäologischen Tätigkeiten, die im Rahmen der
Tell Halaf-Ausgrabung entstanden, zu koordinieren. Die Ausgrabungen aus der
hethitischen Residenz am Siedlungshügel Tell Halaf wurden in einem eigens
gegründeten Tell Halaf-Museum ausgestellt und der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. Die Objekte seiner Orientalia-Sammlung schmückten
dagegen die Wände der Stiftung am Kurfürstendamm in Berlin, wo Oppenheim
auch sein Domizil hatte. Während der Bombenangriffe am Ende des Zweiten
Weltkriegs wurden die Räume der Stiftung wie auch das Tell Halaf-Museum
getroffen, wobei Vieles, vor allem die archäologischen Bestände,
aber auch die wertvollsten Stücke aus islamischer Zeit, zerstört
oder später geplündert wurden. Nur demengagierten Einsatz befreundeter
Mitarbeiter der Stiftung verdanken wir die Rettung der übriggebliebenen
Sammlungsstücke, die heute in Köln und Berlin wieder eine geeignete
Unterbringung erfahren.
Max von Oppenheim starb am 15. November 1946, fast auf den Tag genau 47 Jahre,
nachdem er den Tell Halaf zuerst betreten hatte. Zeit seines Lebens begegnete
er derorientalischen Kultur mit Bewunderung und Respekt. Ohne seine Freundschaft
und persönlichen Beziehungen zu den Menschen im Nahen Osten hätte
sein Lebenswerk nicht in dieser Dimension entstehen können.
Andus Emge